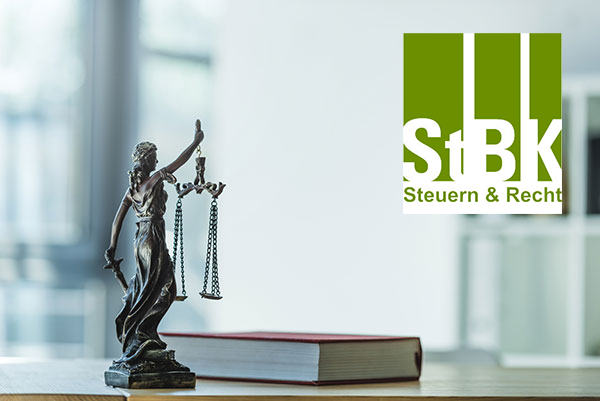Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gehört zu den beliebtesten Rechtsformen für Unternehmen in Deutschland. Sie bietet eine attraktive Kombination aus Haftungsbegrenzung, überschaubarem Gründungsaufwand und hoher Akzeptanz im Geschäftsverkehr. Vor allem kleine Unternehmen und Start-ups entscheiden sich häufig für dieses Modell.
Vom Entschluss bis zur Eintragung
Bevor das Unternehmen offiziell besteht, erfolgt eine erste Einigung der Beteiligten. Diese vorläufige Phase wird juristisch als Vorgründungsgesellschaft bezeichnet. Sobald ein Gesellschaftsvertrag beim Notar beurkundet ist, entsteht die sogenannte GmbH in Gründung. Erst mit dem Eintrag ins Handelsregister wird sie rechtlich wirksam.
Solange dieser letzte Schritt noch aussteht, besteht kein umfassender Haftungsschutz. Geschäfte in dieser Übergangszeit können dazu führen, dass die Initiatoren persönlich für Verluste aufkommen müssen. Daher ist ein strukturierter Ablauf essenziell.
Finanzielle Grundlage
Zur Absicherung der Gesellschaft ist ein Startkapital erforderlich. Der Gesetzgeber schreibt mindestens 25.000 Euro vor. Dabei können auch Sachwerte eingebracht werden, etwa Maschinen oder Fahrzeuge. Für den Handelsregistereintrag genügt es, wenn mindestens die Hälfte dieses Betrags eingezahlt wurde.
Unternehmensführung und Kontrolle
Zwei entscheidende Instanzen sorgen für die Organisation innerhalb der GmbH: die Geschäftsleitung und die Versammlung der Anteilseigner. Erstere ist für das operative Handeln verantwortlich und wird von den Teilhabern ernannt. Ihre Abberufung ist jederzeit durch Mehrheitsbeschluss möglich.
Die Eigentümerversammlung trifft wichtige Entscheidungen, zum Beispiel über Umstrukturierungen, Kapitalveränderungen oder die Auflösung des Unternehmens. In bestimmten Fällen – etwa bei größeren Firmen – ist zusätzlich ein Überwachungsorgan wie ein Aufsichtsrat vorgesehen.
Eigentumsverhältnisse
Anteile können sowohl verkauft als auch vererbt werden. Voraussetzung für eine gültige Übertragung ist immer eine notarielle Beglaubigung. Um unkontrollierte Veränderungen im Gesellschafterkreis zu vermeiden, kann die Satzung eine Zustimmungspflicht anderer Beteiligter vorsehen.
Ausscheiden und Anspruch auf Ausgleich
Teilhaber, die sich trennen möchten oder ausgeschlossen werden, verlieren ihren Anteil, erhalten jedoch in der Regel eine finanzielle Entschädigung. Auch durch Pflichtverletzungen oder Regelverstöße kann ein Verlust der Beteiligung eintreten.
Verantwortung und Risiko
Nach der offiziellen Eintragung haften weder die Teilhaber noch die Geschäftsleitung persönlich für Unternehmensverbindlichkeiten – ausgenommen bei Pflichtverletzungen oder unvollständig geleistetem Kapital. Geschäftsleiter haben eine rechtlich geregelte Sorgfaltspflicht. Verstöße können zu privater Ersatzpflicht führen.