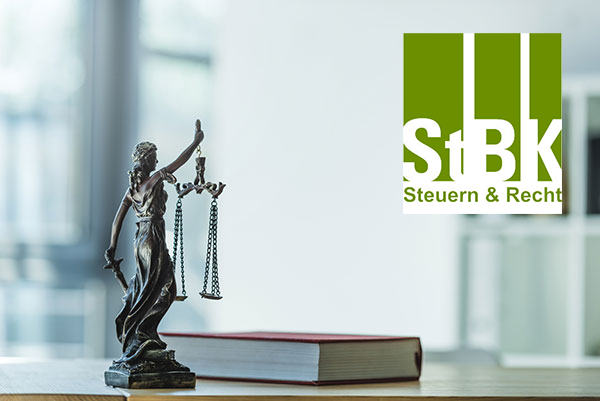Mit einer Patientenverfügung können volljährige Personen festlegen, welche medizinischen Maßnahmen sie in bestimmten Situationen wünschen oder ablehnen – etwa wenn sie selbst nicht mehr urteilsfähig sind. Dadurch lässt sich sicherstellen, dass die eigene Haltung zu Behandlungen berücksichtigt wird, auch wenn keine aktive Zustimmung mehr möglich ist.
Sobald die schriftlich dokumentierten Wünsche auf die aktuelle Lage zutreffen, sind medizinische Fachkräfte und Pflegende an diese gebunden. Wer eine Vorsorgevollmacht erteilt hat, überträgt einer Vertrauensperson das Recht, stellvertretend zu handeln und den festgelegten Willen durchzusetzen.
Ein solches Dokument kann jederzeit geändert oder aufgehoben werden. Zwar ist keine spezielle Form vorgeschrieben, dennoch ist es sinnvoll, sich bei der Erstellung fachkundig beraten zu lassen – etwa durch medizinisches oder rechtliches Personal. So lässt sich vermeiden, dass unklare Formulierungen zu Missverständnissen führen.
Ist keine Patientenverfügung vorhanden oder passt ihr Inhalt nicht zur aktuellen Lage, muss eine bevollmächtigte oder gerichtlich eingesetzte Betreuungsperson gemeinsam mit der Ärztin oder dem Arzt über das weitere Vorgehen entscheiden. Grundlage hierfür ist der sogenannte mutmaßliche Wille, also das, was die betroffene Person vermutlich selbst entschieden hätte.
Bei schwerwiegenden Entscheidungen – etwa über den Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen – kann es zu abweichenden Einschätzungen kommen. In solchen Fällen prüft das zuständige Betreuungsgericht, ob die geplante Maßnahme dem vermuteten Wunsch entspricht.
Rechtlich geregelt ist der Umgang mit einer solchen Verfügung in § 1827 BGB, der die Rahmenbedingungen für Gültigkeit und Anwendung beschreibt.
Das Bundesministerium der Justiz bietet hierzu eine ausführliche Broschüre mit hilfreichen Erläuterungen, Beispielen und Textbausteinen an. Damit lassen sich individuelle Inhalte rechtssicher formulieren. Wer möchte, kann zusätzlich das von den Verbraucherzentralen entwickelte Online-Tool Patientenverfügung nutzen. Es führt Schritt für Schritt durch die Erstellung, bietet verständliche Hinweise zu allen Auswahlmöglichkeiten und ermöglicht das Ausdrucken des fertigen Dokuments.
Neben der Verfügung selbst empfiehlt es sich, durch eine Vorsorgevollmacht eine Person zu benennen, die im Fall der Entscheidungsunfähigkeit auch organisatorische und finanzielle Aufgaben übernimmt. Die Broschüre Betreuungsrecht, ebenfalls vom Bundesministerium bereitgestellt, gibt hierzu umfassende Orientierung.