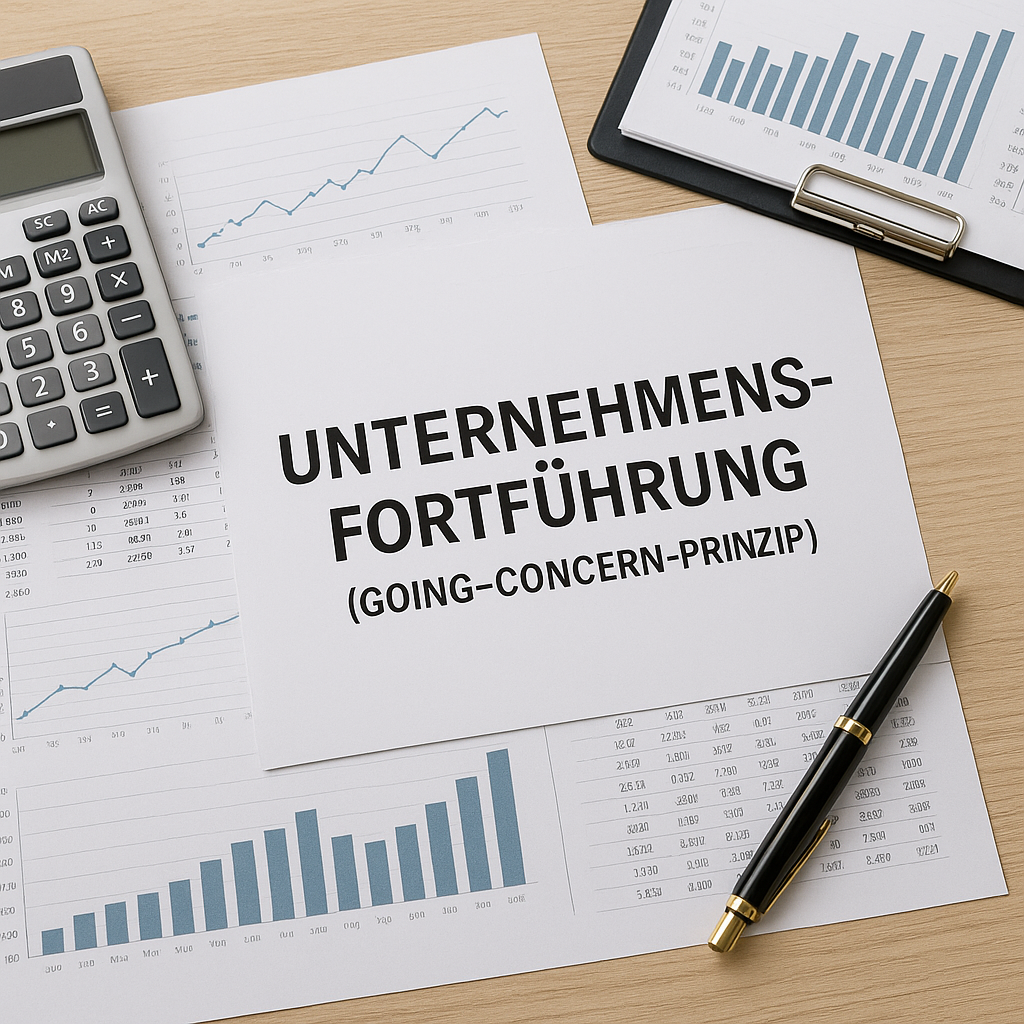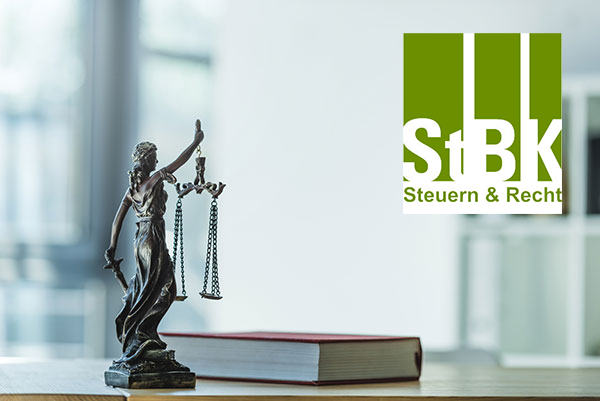Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip)
Das Prinzip der Unternehmensfortführung, international als Going-Concern-Prinzip bezeichnet, zählt zu den grundlegenden Pfeilern der Rechnungslegung. Es basiert auf der Annahme, dass ein Unternehmen seine wirtschaftliche Tätigkeit auch künftig fortsetzt und keine Umstände vorliegen, die eine Beendigung oder Liquidation erwarten lassen. Diese Prämisse ist entscheidend für die Erstellung des Jahresabschlusses, da sie die Grundlage für die Bewertung sämtlicher Bilanzpositionen bildet. Nur wenn konkrete Anzeichen gegen die Fortführungsfähigkeit sprechen, muss eine Bewertung nach Liquidationswerten vorgenommen werden, was erhebliche Auswirkungen auf die Vermögens- und Ertragslage haben kann.
Bedeutung für die Bilanzierung
Das Prinzip gewährleistet, dass die Bilanzierung nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung erfolgt. Solange der Fortbestand als gesichert gilt, werden Vermögenswerte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten erfasst und planmäßig über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Diese Methode spiegelt die kontinuierliche Nutzung der Wirtschaftsgüter wider und ermöglicht eine sachgerechte Ermittlung des periodengerechten Ergebnisses. Wird die Fortführungsannahme aufgegeben, erfolgt die Bewertung auf Basis der erzielbaren Liquidationserlöse. Diese sind in der Regel niedriger, was zu einer deutlichen Verringerung des Eigenkapitals führt und den wahren wirtschaftlichen Zustand in einer Krisensituation abbildet.
Voraussetzungen der Fortführungsannahme
Die Gültigkeit des Going-Concern-Prinzips hängt von der realistischen Erwartung ab, dass das Unternehmen seine Verpflichtungen weiterhin erfüllen kann. Risiken wie dauerhafte Verluste, ein starker Rückgang des Eigenkapitals, Zahlungsschwierigkeiten oder schwebende Insolvenzverfahren können die Annahme gefährden. Die Geschäftsleitung ist verpflichtet, regelmäßig zu beurteilen, ob die Fortführung wahrscheinlich ist. Diese Beurteilung basiert auf Planungsrechnungen, Liquiditätsprognosen, laufenden Finanzierungsverträgen sowie einer Einschätzung der Markt- und Wettbewerbssituation. Ein Zeitraum von mindestens zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag dient in der Regel als Grundlage für diese Prüfung.
Verantwortung von Management und Prüfer
Die Unternehmensleitung trägt die Hauptverantwortung für die Bewertung der Fortführungsfähigkeit. Sie muss mögliche Risiken offenlegen, Gegenmaßnahmen einleiten und die zugrunde liegenden Annahmen nachvollziehbar dokumentieren. Zu den potenziellen Maßnahmen zählen Kostensenkungen, Umstrukturierungen, Kapitalzuführungen oder Neuverhandlungen von Kreditlinien. Der Wirtschaftsprüfer hat die Pflicht, diese Einschätzungen kritisch zu hinterfragen. Erkennt er erhebliche Unsicherheiten, muss er diese im Prüfungsbericht erwähnen oder im Bestätigungsvermerk einen Hinweis auf die eingeschränkte Fortführungsfähigkeit aufnehmen.
Transparenz und Offenlegung
Treten ernsthafte Zweifel an der Fortführung auf, sind diese im Anhang des Jahresabschlusses offenzulegen. Dabei werden die Ursachen, die möglichen Folgen und geplante Gegenmaßnahmen erläutert. Typische Indikatoren sind eine negative Ergebnisentwicklung über mehrere Jahre, erhebliche Liquiditätsengpässe oder die Abhängigkeit von einzelnen Großkunden. Ziel der Offenlegung ist es, ein realistisches Bild der wirtschaftlichen Situation zu vermitteln und das Vertrauen von Investoren, Gläubigern und weiteren Stakeholdern zu erhalten.
Abgrenzung zur Liquidation
Wenn die Fortführungsannahme entfällt, erfolgt die Umstellung auf Liquidationsbewertung. Dabei werden Vermögenswerte zu den zu erwartenden Veräußerungserlösen und Verbindlichkeiten zu den Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Dies markiert den Übergang von einem zukunftsorientierten zu einem abwicklungsbezogenen Bilanzierungsansatz und verdeutlicht, dass das Unternehmen seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann.
Das Going-Concern-Prinzip stellt somit ein zentrales Element der Bilanzierung dar. Es schafft die Grundlage für die verlässliche Darstellung der finanziellen Lage, fördert Transparenz und dient als Frühwarnsystem bei wirtschaftlichen Risiken. Durch die konsequente Anwendung wird sichergestellt, dass der Jahresabschluss die tatsächliche Leistungsfähigkeit und Stabilität eines Unternehmens realistisch widerspiegelt.