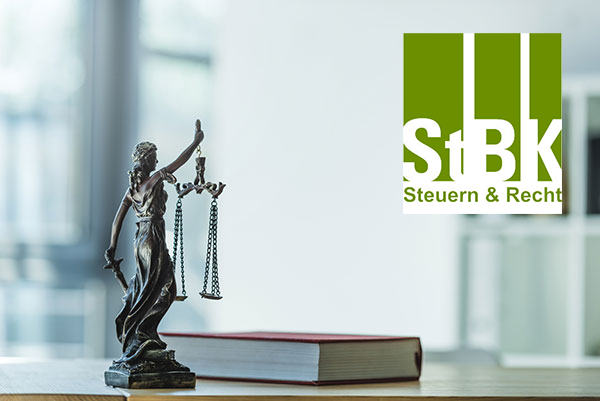Wer in eine Erbfolge eintritt, steht nicht selten vor organisatorischen oder finanziellen Herausforderungen. Besonders in Konstellationen mit mehreren Beteiligten kann die Aufteilung komplex und belastend sein. Eine Möglichkeit, sich aus dieser Situation zu lösen, ist die entgeltliche Überlassung des eigenen Anspruchs.
Gesetzlicher Rahmen
Das Bürgerliche Gesetzbuch regelt in § 2371 die zulässige Übertragung einer Rechtsposition aus einer Hinterlassenschaft. Dabei wird keine physische Sache verkauft, sondern das mit dem Erbfall verbundene Recht. Diese Vereinbarung muss notariell beurkundet werden. Zudem ist eine Mitteilung an das Nachlassgericht erforderlich (§ 2384 BGB), um Rechtssicherheit zu gewährleisten.
Umfang der Veräußerung
Ein allein Begünstigter kann seinen gesamten Anspruch abgeben. Gehört man einer Gruppe gleichberechtigter Personen an, ist nur der eigene Anteil übertragbar. Einzelne Bestandteile der Hinterlassenschaft bleiben dabei unberührt, da sie gemeinschaftlich verwaltet werden.
Mit Vertragsabschluss geht das betreffende Recht in dem Zustand über, in dem es sich zu diesem Zeitpunkt befindet. Spätere Änderungen am Nachlass, wie der Wegfall von Auflagen oder Zuwendungen, wirken sich nicht auf den geschlossenen Vertrag aus.
Vertragspartner und Verantwortung
Die abtretende Person verpflichtet sich zur Weitergabe ihres Anspruchs. Im Gegenzug übernimmt der Erwerber die Rolle innerhalb der Erbstruktur sowie mögliche finanzielle Belastungen, sofern im Vertrag nichts anderes festgelegt wurde.
Ein amtlicher Nachweis über die Berechtigung zur Nachfolge – etwa ein Erbschein – kann nur auf den Namen des ursprünglich Berufenen ausgestellt werden (§ 2353 BGB). Der Käufer kann dieses Dokument jedoch zur Absicherung verlangen.
Besondere Schutzmechanismen
Innerhalb von Gruppen mit mehreren Beteiligten besteht ein befristetes Vorrecht auf Übernahme durch andere. Diese Regelung soll sicherstellen, dass keine fremden Dritten ungewünscht Einfluss auf familiäre Strukturen nehmen.
Die haftungsrechtliche Verantwortung der veräußernden Person bezieht sich ausschließlich auf bestimmte Punkte: die rechtmäßige Nachfolgestellung, das Nichtbestehen nachfolgender Begünstigter, das Fehlen eines Testamentsvollstreckers, sowie das Nichtvorliegen von Sonderanordnungen, Belastungen oder Pflichtteilen.
Für nicht offengelegte Umstände kann nur bei nachweislicher Täuschung gehaftet werden.
Abwägung von Nutzen und Risiko
Der Einstieg in eine erbrechtliche Position kann mit Unsicherheiten verbunden sein. Dazu zählen unklare Vermögensverhältnisse, mögliche Forderungen Dritter oder potenzielle Spannungen mit anderen Beteiligten. Deshalb fällt der gezahlte Preis in der Praxis oft gering aus.
Verwechselt wird dieses Vorgehen häufig mit einem familiären Verzicht. Dabei wird im Vorfeld, meist unter Angehörigen, auf einen künftigen Anspruch verzichtet – allerdings zu Lebzeiten der betreffenden Person und auf anderer rechtlicher Grundlage.