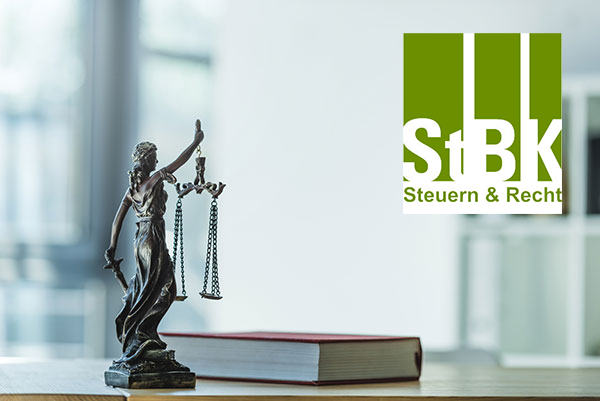Grenzüberschreitende Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften
Mit der Reform des Umwandlungsgesetzes im Jahr 2007 wurde die rechtliche Grundlage für Fusionen von Kapitalgesellschaften über Staatsgrenzen hinweg geschaffen. Die §§ 122a bis 122l UmwG regeln seitdem den Zusammenschluss von Unternehmen aus verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie des Europäischen Wirtschaftsraums. Auf diese Weise können beispielsweise eine deutsche GmbH und eine französische SARL zu einer einzigen Gesellschaft verschmolzen werden. Dabei entsteht eine neue juristische Einheit, in der das Vermögen beider Firmen zusammengeführt wird.
Diese Form der Unternehmensumstrukturierung ist jedoch nur bestimmten Gesellschaften vorbehalten. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Kapitalgesellschaften, deren Gründung nach dem Recht eines EU- oder EWR-Staates erfolgt ist. Außerdem muss sich ihr Sitz, die Hauptverwaltung oder zumindest eine bedeutende Niederlassung im Bereich der Europäischen Union oder des EWR befinden. Andere Rechtsformen wie Genossenschaften oder Investmentgesellschaften sind von der grenzüberschreitenden Verschmelzung ausgeschlossen, da sie nicht den Voraussetzungen des Gesetzes entsprechen.
Das gesetzliche Verfahren ist mehrstufig aufgebaut und verfolgt den Zweck, Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu gewährleisten. Der erste Schritt besteht in der Ausarbeitung eines Verschmelzungsplans, der sowohl die organisatorischen als auch die finanziellen Rahmenbedingungen des Zusammenschlusses festlegt. Dieser Plan muss zur Eintragung beim Handelsregister eingereicht und anschließend veröffentlicht werden, um Dritte über das Vorhaben zu informieren.
Ein weiterer verpflichtender Bestandteil des Fusionsprozesses ist der Verschmelzungsbericht. Dieser dient der Aufklärung der Anteilseigner über die Beweggründe, den Ablauf und die Folgen der geplanten Maßnahme. Dabei werden insbesondere die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erläutert. Zusätzlich erfolgt eine unabhängige Prüfung durch einen Sachverständigen, der die Angemessenheit der getroffenen Regelungen kontrolliert und potenzielle Risiken bewertet.
Die Gesellschafter müssen dem Zusammenschluss zustimmen. Dabei wird festgelegt, wie die jeweiligen Anteile der beteiligten Unternehmen im neuen Konstrukt umgerechnet werden. Minderheitsgesellschafter können unter bestimmten Voraussetzungen die Angemessenheit des Umtauschverhältnisses gerichtlich überprüfen lassen, sofern das Recht des anderen Staates dies zulässt oder alle beteiligten Unternehmen zustimmen.
Außerdem verpflichtet das Gesetz die Gesellschaften, den Aktionären, die sich nicht an der neuen Struktur beteiligen wollen, eine Abfindung anzubieten. Diese Regelung ermöglicht es, Eigentumsrechte auszugleichen und den Austritt aus der Gesellschaft zu ermöglichen. Für Gläubiger kann es notwendig sein, Sicherheiten bereitzustellen, um deren Forderungen auch nach der Verschmelzung abzusichern.
Nach erfolgreicher Durchführung aller Verfahrensschritte erteilt das zuständige Registergericht eine Verschmelzungsbescheinigung. Diese Urkunde ist Voraussetzung für die Eintragung in das Handelsregister, womit der Zusammenschluss rechtsgültig abgeschlossen wird.
Durch diese Regelungen wird die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa erleichtert und Unternehmen erhalten die Möglichkeit, international wettbewerbsfähige Strukturen zu schaffen.