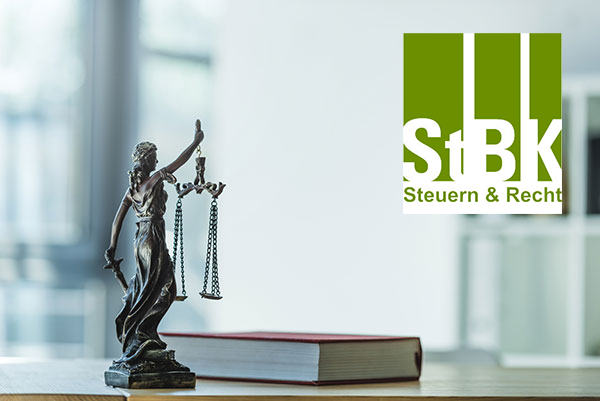Erbschleicherei – Wie Erbe zur Täuschung genutzt wird
Erbstreitigkeiten sind kein seltenes Phänomen – besonders dann, wenn plötzlich Menschen im Testament stehen, die vorher keine Rolle im Leben des Erblassers gespielt haben. Hier taucht oft der Verdacht auf, dass jemand sich das Vertrauen erschlichen hat, um begünstigt zu werden. Die Rede ist von Erbschleicherei.
Was bedeutet das eigentlich?
Obwohl der Begriff häufig verwendet wird, ist er im Gesetz nicht eindeutig geregelt. Er beschreibt ein Verhalten, bei dem sich jemand durch gezielte Annäherung und psychischen Einfluss einen Platz im Testament sichert. Erbschleicher nutzen häufig persönliche Schwächen des Erblassers – etwa Einsamkeit, Krankheit oder Hilflosigkeit – und bauen ein Verhältnis auf, das nicht immer ehrlich gemeint ist.
Rechte und Grenzen im Erbrecht
In Deutschland hat jeder das Recht, selbst zu bestimmen, wem sein Vermögen nach dem Tod zufällt. Diese Testierfreiheit schützt individuelle Entscheidungen. Dennoch sind nahe Verwandte durch das Gesetz abgesichert – sie erhalten ihren Pflichtteil, selbst wenn sie im Testament nicht genannt wurden.
Wann ist Vorsicht geboten?
Wenn eine außenstehende Person innerhalb kurzer Zeit starken Einfluss auf eine ältere oder schwache Person gewinnt und danach im Testament auftaucht, sollte das Umfeld aufmerksam werden. Oft wird der Kontakt zu Familie oder Freunden plötzlich eingeschränkt – ein mögliches Zeichen dafür, dass Einfluss genommen wird.
Wie kann man dagegen vorgehen?
Ist der Verdacht begründet, sollte zunächst überprüft werden, ob das Testament formal gültig ist. Wurde der Erblasser durch Drohungen oder falsche Informationen zur Änderung seiner letztwilligen Verfügung gebracht, kann das Dokument angefochten werden – allerdings nur innerhalb eines Jahres ab Kenntnis (§ 2078 BGB).
Was passiert bei schwerwiegendem Fehlverhalten?
Liegt ein besonders gravierender Vorfall vor, kann eine Erbunwürdigkeit des Begünstigten in Betracht gezogen werden. Diese wird beispielsweise dann anerkannt, wenn jemand den Erblasser zur Unterschrift gedrängt oder ihn bewusst von der Erstellung eines Testaments abgehalten hat. Die rechtlichen Grundlagen finden sich im § 2339 BGB.
Gibt es strafrechtliche Folgen?
Zwar ist Erbschleicherei selbst kein eigener Straftatbestand, doch einzelne Handlungen innerhalb dieses Verhaltens können durchaus strafbar sein – etwa:
- Einschüchterung (Nötigung)
- Täuschung mit Bereicherungsabsicht (Betrug)
- Veränderung von Dokumenten (Urkundenfälschung)
Solche Fälle werden unabhängig vom Erbrecht nach dem Strafgesetzbuch geahndet.
Ruhe bewahren – Beweise sichern
Wer einen Erbschleicher vermutet, sollte nicht vorschnell handeln. Verdächtigungen ohne stichhaltige Beweise können juristisch nach hinten losgehen. Der erste Schritt sollte immer eine rechtliche Beratung sein, um mögliche Wege wie Anfechtung oder Antrag auf Erbunwürdigkeit sicher einzuschätzen.